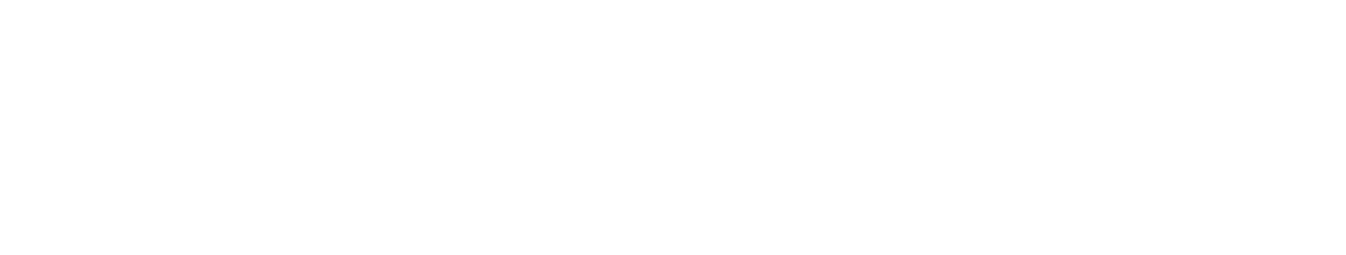Weitere Gebiete
Im Regelfall leben Eheleute ab Eheschließung im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Nur durch notarielle, formbedürftige Vereinbarung können die Eheleute einen anderen Güterstand wählen.
Vielfach verbreitet ist die Ansicht, mit Eheschließung müsse der Ehepartner für etwaige vorhandene Verbindlichkeiten des anderen mithaften, und dies sei ein Grund, um eventuell Gütertrennung zu vereinbaren. Dies ist schlichtweg falsch. Jeder haftet für seine eigenen Schulden. Nur wenn Sie gemeinsam eine Verbindlichkeit eingehen, haften die Eheleute beide. Im positiven Sinn gehört Ihnen natürlich im Regelfall alles gemeinsam, was Sie während der Ehe gemeinsam anschaffen.
Was Ihnen vor der Ehe allein gehörte oder während der Ehe durch Erbschaft zufällt, ist und bleibt Ihr Vermögen, der Ehepartner hat beim gesetzlichen Güterstand lediglich bezüglich des Zugewinns einen möglichen Ausgleichsanspruch.
Beim Zugewinn wird also die jeweilige Differenz zwischen Anfangs- und Endvermögen beider Eheleute ausgeglichen, bzw. hälftig geteilt. Für den Zeitraum des Ausgleichs ist der Tag der Eheschließung bis zum Tag der Zustellung des Scheidungsantrags -bezeichnet als Stichtag – maßgeblich.
Lebenspartnerschaft
Haben Sie nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eine Lebenspartnerschaft begründet, ergeben sich hieraus im Wesentlichen die gleichen Rechte und Verpflichtungen wie bei einer Ehe.
Das Lebenspartnerschaftsgesetz verweist unmittelbar auf die entsprechenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Trennen Sie sich, besteht gegebenenfalls ein Anspruch auf Unterhalt bei Getrenntleben. Die Aufhebung der Lebenspartnerschaft kann nach einjähriger Trennung vor dem zuständigen Familienrichter beantragt werden.
Für die Aufhebung gelten die Vorschriften über den Versorgungsausgleich oder etwa ein Anspruch auf nachpartnerschaftlichen Unterhalt entsprechend denen über die Scheidung einer Ehe.
Gewaltschutz
Leider kommt es immer häufiger in Partnerschaften zu häuslicher Gewalt. Gegen die Fortsetzung, bzw. Wiederholung von Gewalt gegen Ihre Person können Sie sich nach dem Gewaltschutzgesetz schützen.
Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie in einer Ehe, nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder in einer Lebenspartnerschaft gemeinsam in einer Wohnung leben.
Zunächst besteht bei häuslicher Gewalt die Möglichkeit unmittelbar nach der Tat die Polizei zu rufen. Diese kann dann nach dem Polizeigesetz NRW gegenüber der gewalttätigen Person einen Wohnungsverweis aussprechen.
Es ist hiernach einer gewalttätig in Erscheinung getretenen Person zunächst für die Dauer von zwei Wochen untersagt, in die Wohnung zurückzukehren. Vor Ablauf dieser Frist sollte in jedem Fall überprüft werden, ob bei dem zuständigen Familiengericht im Wege einer einstweiligen Anordnung ein Antrag auf Wohnungszuweisung nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt werden soll.
Wird durch das Familiengericht die beantragte Anordnung beschlossen, erfolgt eine meist auf mehrere Monate befristete Wohnungszuweisung.
Die endgültige Zuweisung der Wohnung kann in einem Hauptsacheverfahren geregelt werden.
Gemeinsames Wohnungsmietverhältnis bei Trennung
Besteht bei Trennung ein Wohnraummietverhältnis, können – oftmals erst nach Monaten oder gar Jahren – erhebliche Probleme entstehen.
Derjenige, der aus der ehemals gemeinsamen Wohnung auszieht, haftet gegenüber dem Vermieter weiterhin aus dem Mietverhältnis, wenn beide Partner den Mietvertrag unterschrieben haben, oder ein Partner erst später in das bereits bestehende Mietverhältnis aufgenommen wurde.
So kann – etwa bei plötzlich ausbleibender Mietzahlung – auch der nicht mehr in der Wohnung lebende ehemalige Partner vom Vermieter gesamtschuldnerisch in Anspruch genommen werden.
Derjenige, der aus der Wohnung auszieht, kann das Mietverhältnis auch nicht alleine kündigen! Sie können das Mietverhältnis nur durch gemeinsame Erklärung wirksam kündigen. Oder Sie können mit einem (verständigen) Vermieter eine „Entlassung aus dem Mietverhältnis“ einer Person vereinbaren. Das Mietverhältnis wird dann nur mit dem in der Wohnung verbliebenden Partner fortgesetzt.
Im ungünstigsten Fall kann der (ehemalige) Partner auf die Zustimmung zu Kündigung des Mietverhältnisses vor dem Familiengericht verklagt werden.
Steuerrecht
Meist werden Eheleute gemeinsam zur Einkommenssteuer veranlagt.
Bei Trennung muss im Regelfall für das Folgejahr die getrennte steuerliche Veranlagung beantragt werden.
Besteht dann ggf. für einen zurückliegenden Zeitraum ein Steuererstattungsanspruch, kommt es oftmals zwischen den ehemaligen Partnern zur Auseinandersetzung über die Aufteilung.
Auch für Streitigkeiten, die sich ggf. hieraus ergeben, bietet sich von Anfang an eine anwaltliche Vertretung an.
Ggf. muss ein Anspruch auf Aufteilung einer Steuererstattung, wie auch andere steuerrechtliche Ansprüche im Innenverhältnis, vor dem Familiengericht geltend gemacht werden.
Abstammung/Vaterschaft
Sind Sie wirklich der Vater? Bei berechtigten Zweifeln kann die Vaterschaft angefochten werden.
Anfechtungsberechtigt sind übrigens grundsätzlich auch die Mutter und das Kind.
Bei der Anfechtung sind gesetzliche Fristen zu beachten. Spätestens wenn Sie von Umständen erfahren, die gegen die Vaterschaft sprechen, beginnt eine (meist) zweijährige Anfechtungsfrist.